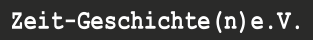-
Mo.27Jan.202518 - 20 UhrPuschKino Halle
Kurzfilme und Gespräch in der Reihe "Stolpersteine - Filme gegen das Vergessen" im Puschkino
Anlässlich des Holocaust-Gedenkens zeigt das Puschkino in Kooperation mit dem Stadtmuseum Halle, der jüdischen Gemeinde sowie dem Master-Studiengang Multimedia und Autorschaft fünf Dokumentarfilme aus der Filmreihe "Stolpersteine - Filme gegen das Vergessen", in deren Mittelpunkt weibliche Perspektiven stehen. Laufzeit der fünf Filme: 90 min. Nach der Vorführung findet ein Gespräch mit den Autorinnen der Filme statt.
Mit „I am always running behind” - Erfahrungen jüdischer Frauen lädt die Reihe Stolpersteine – Filme gegen das Vergessen ein, den Lebenswegen von Bella Traubkatz, Irene Eber, Gudrun Goeseke, Frieda Göhre und Rosa Teplitzki zu folgen und über Ausgrenzung und Migration aus femininer Perspektive ins Gespräch zu kommen.
Die Produktionen aus der Filmreihe zeigen, wie Gudrun Goeseke die Namen und Daten der halleschen Juden rettet, begleiten Irene Eber in Jerusalem dabei ihre Lebensgeschichte von Halle über das Ghetto Mielec bis zur eigenen Professur in Israel zu rekapitulieren und würdigen den Lebensweg von Bella Traubkatz, die ihre bekannteren Brüder Lion und Martin Feuchtwanger als Redakteurin unterstützt hat. Frieda Göhre ist Schneiderin und Mutter eines Kindes, dann erkrankt sie psychisch und wird deshalb verfolgt und ermordet. Ihrem kurzen Leben ist ein weiterer Film gewidmet. Während das Leben dreier Frauen der jüdischen Gemeinde Halle heute und wie Flucht und Ausgrenzung sich in die jüdischen Leben der Gegenwart einschreiben, im Mittelpunkt eines weiteren Kurzfilms stehen.
Hintergrund
Am 27. Januar 2025 jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 80. Mal. Der Tag ist dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus gewidmet. Aus diesem Anlass werden im Puschkino Kurzfilme zu Stolpersteinen in Halle gezeigt. Vor vielen Wohnhäusern in europäischen Städten erinnern Stolpersteine an Menschen, die einst dort lebten und vom NS-Regime verfolgt und getötet wurden.
Seit 2016 werden die in Kooperation mit dem Zeitgeschichte(n) e. V. und weiteren Partnern entstandenen Filme jährlich im Januar gezeigt. -
Do.13Feb.202511 - 17 UhrZeit-Geschichte(n) e.V., Große Ulrichstraße 51, 06108 Halle/Saale („Kulturinsel“) Tram-Haltestelle „neues theater“, Eingang über Schulstraße
Da die Beratung in Einzelgesprächen erfolgt ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Die Gesprächstermine werden von der Behörde des Beauftragten
des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur vergeben:
unter Telefon 0391 / 560 - 15 01
oder per Fax 0391 / 560 - 15 20Das Beratungsangebot richtet sich an Menschen, die bis heute in vielfältiger Weise unter verübtem Unrecht durch den SED-Staat leiden, insbesondere an:
- zu Unrecht Inhaftierte,
- Betroffene von Zersetzungsmaßnahmen des Staatssicherheitsdienstes,
- Personen, die Repressalien in Beruf oder Ausbildung ausgesetzt waren,
- Betroffene, die Eingriffe in Eigentum und Vermögen erfuhren,
- Verschleppte und deren Angehörige sowie Hinterbliebene und Angehörige von Opfern,
- Personen, die nach Akteneinsicht eine Retraumatisierung erlitten.
Es können Anträge auf Einsicht in die Stasi-Akten gestellt werden. Hierzu ist der Personalausweis vorzulegen.
Weiterhin erfolgt eine Beratung zu
- Anträgen nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen (strafrechtliche, verwaltungsrechtliche, berufliche Rehabilitierung) (Antragsfrist aufgehoben)
- monatlichen Zuwendung („Opferrente“) (Mindesthaftzeit auf 90 Tage reduziert)
- Kinderheimen (Vermutungsregelung zu Spezialheimen eingeführt)
- Anträgen nach sowjetischer Inhaftierung/Internierung
Auch Angehörige von offiziellen und inoffiziellen Mitarbeitern des MfS können sich beraten lassen.
-
Di.11März2025
Am Dienstag, 11. März werden an vier Adressen neue STOLPERSTEINE verlegt:
9 Uhr
Huttenstraße 83
Hier wohnte Darga Brynych
Draga Brynych wurde 1901 als Darga Lewin geboren. Seit ihrer Heirat 1925 lebte sie in der Huttenstraße 83. Die Ehe mit ihrem nichtjüdischen Mann Franz Brynych bot ihr zunächst Schutz vor der Deportation. Als ihr Mann im Januar 1944 nach schwerer Krankheit starb, wurde sie nur wenige Wochen später abgeholt und deportiert. Wohin sie gebracht wurde ist unbekannt. Sie überlebte den Holocaust nicht.
Hier zur ausführlichen Biographie >>>Patenschaft: Karsten Mettendorf
9:30 Uhr
Riebeckplatz 8
Hier wohnten Max, Arthur und Karola Mendel
Wo heute ein Neubaublock direkt auf den Riebeckplatz schaut, stand einst das Wohnhaus von Familie Mendel.
Max Mendel (*1871) hatte drei Kinder: Karola Mendel entkam 1939 in die USA. Hans Mendel war bereits kurz vor 1933 von Berlin nach Holland verzogen, wo er den Holocaust versteckt mit seiner Frau überlebte. Arthur wurde in der Reichspogromnacht 1938 verhaftet und in das Konzentrationslager Buchenwald gebracht. Er wurde mit der Auflage entlassen, sofort das Land zu verlassen. Er flüchtete nach Holland. Dort lebte er in verschiedenen Flüchtlingslagern, zuletzt im Lager Westerbork, wo er als Bibliothekar beschäftigt war. Von dort wurde er mit seiner Frau, die er in Westerbork kennengelernt hatte, nach Theresienstadt gebracht und später weiter nach Auschwitz. Er wurde später für tot erklärt. Max Mendel musste seine Wohnung verlassen, zunächst in ein sog. Judenhaus ziehen, später in das offiziell als Alten- und Siechenheim bezeichnete Gebäude auf dem Gelände des Jüdischen Friedhofs in der Dessauer Straße. Von dort wurde er nach Theresienstadt deportiert, wo er 1942 starb.
Hier zur ausführlichen Biographie >>>Die Verlegung findet in Anwesenheit der Nachfahren von Max Mendel statt, die aus Holland und Großbritannien anreisen.
Patenschaften: Hallesche Gästeführer e.V., Elisabeth-Gymnasium Halle
10 Uhr
Willy-Brandt-Straße 47
Hier wohnte Franz Peters
Franz Peters (*1888) war Reichstagsabgeordneter für die SPD und stimmte am 23.3.1933 gegen das Ermächtigungsgesetz, das quasi die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland bedeutete. Als er im Mai 1933 verhaftet wurde, brach Peters, der in den politisch aufreibenden Jahren zuvor ein Herzleiden entwickelt hatte, zusammen und starb im August 1933.
Hier zu ausführlichen Biographie >>>Die Verlegung findet in Anwesenheit der Enkelin von Franz Peters statt. Die Patenschaft für den Stolperstein übernimmt die SPD Halle.
10:30 Uhr
Am Kirchtor 26
Hier wohnte Ernst Thiele
Ernst Thiele wurde 1908 in Halle-Trotha geboren. Er stammte aus einfachen Verhältnissen und übte verschiedene berufliche Tätigkeiten aus. Immer wieder geriet er wegen kleinerer Vergehen mit dem Gesetz in Konflikt und wurde 1941 zu drei Jahren Zuchthaus mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Während des Nationalsozialismus wurden Vergehen wie die Thieles härter als zuvor geahndet, er galt als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher und wurde zur Arbeit in das Konzentrationslager Mauthausen, später nach Auschwitz-Monowitz gebracht, wo er Häftling war und keine Position inne hatte. Thiele überlebte die Lager, wurde jedoch kurz nach der Befreiung, am 15. Mai 1945, erneut festgesetzt und in die Sowjetunion gebracht. Ein Sowjetisches Militärgericht verurteilte ihn 1949 zu 25 Jahren Arbeitsbesserungslager. Vorgeworfen wurde ihm die Beteiligung an Massenverbrechen während des Nationalsozialismus. Seine Schuld wurde nie überprüft. 1955 wurde er in die DDR-Haft überstellt, wo er weiter seine Unschuld beteuerte. 1974 wurde Thiele in die Freiheit entlassen. Mehrere tatsächliche Täter, die mit Thiele in sowjetischer Haft waren, sind zu diesem Zeitpunkt schon längst in Freiheit.Hier zur ausführlichen Biographie >>>
Aufgrund der nur schätzbaren Fahrtzeiten zwischen den Verlegestellen kann es zu leichten zeitlichen Abweichungen kommen.
-
Do.13März202511 - 17 UhrZeit-Geschichte(n) e.V., Große Ulrichstraße 51, 06108 Halle/Saale („Kulturinsel“) Tram-Haltestelle „neues theater“, Eingang über Schulstraße
Da die Beratung in Einzelgesprächen erfolgt ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Die Gesprächstermine werden von der Behörde des Beauftragten
des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur vergeben:
unter Telefon 0391 / 560 - 15 01
oder per Fax 0391 / 560 - 15 20Das Beratungsangebot richtet sich an Menschen, die bis heute in vielfältiger Weise unter verübtem Unrecht durch den SED-Staat leiden, insbesondere an:
- zu Unrecht Inhaftierte,
- Betroffene von Zersetzungsmaßnahmen des Staatssicherheitsdienstes,
- Personen, die Repressalien in Beruf oder Ausbildung ausgesetzt waren,
- Betroffene, die Eingriffe in Eigentum und Vermögen erfuhren,
- Verschleppte und deren Angehörige sowie Hinterbliebene und Angehörige von Opfern,
- Personen, die nach Akteneinsicht eine Retraumatisierung erlitten.
Es können Anträge auf Einsicht in die Stasi-Akten gestellt werden. Hierzu ist der Personalausweis vorzulegen.
Weiterhin erfolgt eine Beratung zu
- Anträgen nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen (strafrechtliche, verwaltungsrechtliche, berufliche Rehabilitierung) (Antragsfrist aufgehoben)
- monatlichen Zuwendung („Opferrente“) (Mindesthaftzeit auf 90 Tage reduziert)
- Kinderheimen (Vermutungsregelung zu Spezialheimen eingeführt)
- Anträgen nach sowjetischer Inhaftierung/Internierung
Auch Angehörige von offiziellen und inoffiziellen Mitarbeitern des MfS können sich beraten lassen.
-
Do.13März202515 UhrGedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, Andreasstraße 37a, 99084 Erfurt
Eröffnung der Sonderausstellung „Jugendstrafvollzug in der DDR“
mit Vortrag und Kuratorenführung von Dr. Udo GrashoffIm Nordosten der Stadt Halle, im Stadtteil Frohe Zukunft gelegen, befand sich seit 1971 das ›Jugendhaus Halle‹. Es war die größte und modernste Jugendhaftanstalt der DDR. Sie beherbergte zeitweise bis zu 1.200 männliche, meist jugendliche Häftlinge.
Die Ausstellung informiert anschaulich über das Geschehen hinter den Gefängnismauern und gibt Einblicke in den Haftalltag. Dieser war durch strikten Tagesablauf, militärischen Drill und Drangsalierung, aber auch durch Eigensinn der Inhaftierten gekennzeichnet. Machtmissbrauch durch Bedienstete und die oft mit brutaler Gewalt durchgesetzte Häftlingshierarchie konterkarierten den offiziellen Erziehungsanspruch.Die Ausstellung wurde vom Zeit-Geschichte(n) e.V. Halle erstellt und gefördert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Sie ist vom 11.3. bis zum 21.5.25 in der Gedenkstätte zu sehen.
Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag 12 – 20 Uhr Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertage 10 – 18 Uhr Montag geschlossen https://stiftung-ettersberg.de/gedenkstaette-andreasstrasse/geschichte-des-ortes/
-
Mo.31März202515 UhrHalle, Adolf-von-Harnack-Straße 18
STOLPERSTEINE für Gertrud Katz geb. Ellefsen und ihre Kinder Ruth und Manfred Katz
Am Montag, den 31.3. werden um 15 Uhr in der Adolf-von-Harnack-Straße 18 STOLPERSTEINE für Gertrud Katz und ihre Kinder Ruth und Manfred verlegt. Hier lebte die Familie, zu der auch Willy Katz als Familienvater gehörte und für den an dieser Stelle bereits ein Stein liegt.
Gertrud Katz wurde 1892 in Halle in eine evangelische Familie geboren. 1920 heiratete sie den jüdischen Versicherungsagenten Willy Katz und trat vor der Hochzeit zum Judentum über. 1922 wurde Tochter Ruth, 1928 Sohn Manfred geboren. Ab 1933 nahmen Einschränkungen und Schikanen für die Familie, die der jüdischen Gemeinde angehörte, stetig zu. Im Zuge der Reichspogromnacht im November 1938 wurde Willy Katz festgenommen und in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Er starb am 25. Dezember 1938, kurz nach seiner Entlassung, an den Folgen der erlittenen Misshandlungen.
Gertrud Katz musste nun allein für die Kinder sorgen. Da Ruth und Manfred als Juden galten und keine staatlichen Schulen mehr besuchten durften, suchte ihre Mutter für sie andere Möglichkeiten. Für Ruth fand sie eine Ausbildungsstelle in Bad Kissingen, Manfred konnte die Israelitische Gartenbauschule in Ahlem bei Hannover besuchen. Als diese geschlossen wurde, wechselte er an die Höhere Israelitische Schule in Leipzig, bis auch diese geschlossen wurde. Ab 1942 mussten Ruth und Manfred Zwangsarbeit auf dem jüdischen Friedhof in der heutigen Dessauer Straße leisten. Hier war ein „Alten- und Siechenheim“ eingerichtet worden, in dem zahlreiche jüdische Hallenser bis zu ihrer Deportation zwangsweise leben mussten. Am 18. Februar 1945 wurden Ruth und Manfred Katz nach Theresienstadt deportiert. Dort erlebten sie am 9. Mai 1945 die Befreiung und kehrten zu ihrer Mutter zurück. 1946 zog die Familie nach Berlin, 1948 wanderte sie nach Israel aus. Dort starb Gertrud Katz 1980 im Alter von 88 Jahren. Ruth Katz starb 1989 mit 67 Jahren, Manfred Katz starb 2018 mit 90 Jahren. Ihre Kinder, Enkel und Urenkel leben heute in Israel und Europa.Die Verlegung findet in Anwesenheit von Manfred Katz` Tochter Michal Saar Bleiweiss statt.
Die Patenschaften haben übernommen: Lyonel-Feininger-Gymnasium, Integrierte Gesamtschule Am Steintor und Dana Meuschke
Familie Katz im Jahr 1931
-
Mi.02Apr.2025
Ausstellung zur Disziplinierung in Venerologischen Stationen und Spezialheimen der DDR mit Begleitprogramm:
Mittwoch, 02.04.202516:30 Uhr Ratshof Halle 1. Etage
Eröffnung der Wanderausstellung
EINWEISUNGSGRUND: HERUMTREIBEREI - Disziplinierung in Venerologischen Stationen und Spezialheimen der DDR
Begrüßung durch Daniela Suchantke (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Halle, Johannes Beleites (Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt) sowie den Ausstellungskuratorinnen Juliane Weiß und Hannes Schneider.
Die Ausstellung ist im Ratshof zu sehen vom 2.4.-9.5. Mo bis Fr 8–20 Uhr
www.einweisungsgrund-herumtreiberei.de18 Uhr, Christian-Wolff-Saal im Stadtmuseum Halle, Große Märkerstraße 10, 06108 Halle
Vortrag: »Geschlossene Venerologische Station in der DDR« von Prof. Dr. Florian Steger (Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm)Samstag, 26.04. 15 Uhr Dornrosa e.V., Karl-Liebknecht-Str. 34, 06114 Halle
Zeitzeugengespräch mit einer Betroffenen der Geschlossenen
Venerologischen Station Leipzig-ThonbergMittwoch, 30.04.
10–16 Uhr, Dornrosa e.V., Karl-Liebknecht-Str. 34, 06114 Halle
Beratungsangebot für Betroffene der Geschlossenen Venerologischen Stationen.
Mit Alina Degener (Psychosoziale Erstberatung) und Maximilian Heidrich (Fragen von Rehabilitierung und Entschädigung).16:30–18 Uhr
Erzählcafe im Dornrosa e.V.
Zu den Venerologischen Stationen in der DDR. Für Betroffene und Interessierte.
Sonntag, 04.05. 14 Uhr
Stadtrundgang
»Einweisungsgrund: Herumtreiberei. Auf den Spuren der Geschlossenen Venerologischen Station Halle« von Lea Schulte
und Katharina Eger.
Treffpunkt vor dem Ratshof Halle.Ausstellung und Begleitprogramm sind eine Kooperation von
Initiative Riebeckstraße 63, Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau, Stadt Halle, Dornrosa e.V., Beauftragter des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Stadt Halle. Ausstellung und Begleitprogramm wurden gefördert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. -
Do.10Apr.202511 - 17 UhrZeit-Geschichte(n) e.V., Große Ulrichstraße 51, 06108 Halle/Saale („Kulturinsel“) Tram-Haltestelle „neues theater“, Eingang über Schulstraße
Da die Beratung in Einzelgesprächen erfolgt ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Die Gesprächstermine werden von der Behörde des Beauftragten
des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur vergeben:
unter Telefon 0391 / 560 - 15 01
oder per Fax 0391 / 560 - 15 20Das Beratungsangebot richtet sich an Menschen, die bis heute in vielfältiger Weise unter verübtem Unrecht durch den SED-Staat leiden, insbesondere an:
- zu Unrecht Inhaftierte,
- Betroffene von Zersetzungsmaßnahmen des Staatssicherheitsdienstes,
- Personen, die Repressalien in Beruf oder Ausbildung ausgesetzt waren,
- Betroffene, die Eingriffe in Eigentum und Vermögen erfuhren,
- Verschleppte und deren Angehörige sowie Hinterbliebene und Angehörige von Opfern,
- Personen, die nach Akteneinsicht eine Retraumatisierung erlitten.
Es können Anträge auf Einsicht in die Stasi-Akten gestellt werden. Hierzu ist der Personalausweis vorzulegen.
Weiterhin erfolgt eine Beratung zu
- Anträgen nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen (strafrechtliche, verwaltungsrechtliche, berufliche Rehabilitierung) (Antragsfrist aufgehoben)
- monatlichen Zuwendung („Opferrente“) (Mindesthaftzeit auf 90 Tage reduziert)
- Kinderheimen (Vermutungsregelung zu Spezialheimen eingeführt)
- Anträgen nach sowjetischer Inhaftierung/Internierung
Auch Angehörige von offiziellen und inoffiziellen Mitarbeitern des MfS können sich beraten lassen.